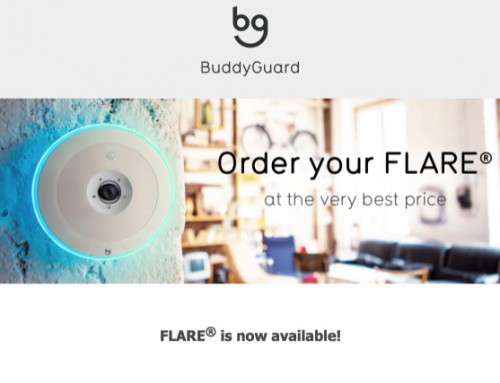Auch wir im Osten hatten vom lieben Gott gehört. Da er in der Schule nicht so das große Thema war (was jetzt ein Euphemismus ist), stellte man ihn sich im besten Fall als eine Art allmächtiger und großartiger Großvater vor, der alles für einen Regeln könnte. Wie man so als Kind ist, versuchte ich es auch ein paar Mal mit ein paar Wünschen an ihn, aber er war wohl gerade sehr beschäftigt, und konnte sich um meine meist sehr dringlichen Wünsche nicht kümmern (meist ging es um verschwundene Schlüssel um der Wahrheit genüge zu tun), denn gerade Anfang der achtziger Jahre war Gott sehr mit dem Weltfrieden und der atomaren Abrüstung beschäftigt.
Wird man enttäuscht, wendet man sich ab. Da ich keine große Erwartungen hatte und die damit nur geringfügig enttäuscht worden waren, konnte ich damit leben. Die Kirche als Institution vermisste ich gar nicht, obwohl es schon irgendwie cool war, das meine Mutter zusätzlich noch eine Patentante hatte, die ihr zum Geburtstag etwas schenkte – dieses Patending führte man allerdings ad absurdum, indem man dafür eine Tante aussuchte, die nach meinem kindlichen Verständnis ja sowieso was zu schenken hatte.
Man wird langsam erwachsen und während der Zeit trieb ich mich häufiger in Kirchen herum, was aber mehr akustische und musikalische Gründe hatte: Orgeln hatte. Nach meinem Klavierunterricht marschierte ich meist schnurstracks in die Kirche gegenüber der Klavierlehrerin, denn dort gab es Mittwochs meistens Orgelkonzerte. Mir blieb dadurch sowohl der Tanzunterricht erspart wie auch »Denver Clan«.
Gott oder auch irgendeiner Kirche brachte mich das jedoch nicht näher. Mit siebzehn blätterte ich das erste Mal in einer Bibel, denn mein Wohnheim-Zimmer-Genosse war bei der Neuapostolischen. Mancher wäre vielleicht zurück gezuckt, aber da er gern singen und beten ging, hatte ich das Zimmer abends wenigstens für mich. Ich glaube, ich fand das gut. Die Geschichten die er aus und von seiner Kirche erzählte, vielleicht war das ein unbewusster Drang zu missionieren, brachten mich nicht weiter: Mir war schon die Organisation ziemlich suspekt. Zumal die Neuapostolen tatsächlich noch einen Zehnten hatten. Hier kommt wieder ein materialistischer Gedanke (wie schon bei der Geschichte mit der Patin) zum Tragen: Selbst von seinem mageren Lehrlingslohn musst er zehn Prozent abgeben – völlig uncool. Ich habe das Geld lieber in Bücher und Schallplatten investiert, wenn es was anständiges gab.
Kurz nach der Wende kam ich in einen Gesprächskreis, der irgendwie zu einer der freikirchlichen Gemeinde gehörte und in der eine Menge Jugendliche versammelt waren. Es wurde über Gott und die Welt geredet. Hauptsache über das Erstere. Auf jede meiner Fragen, hatten die eine Antwort. Sehr beeindruckend. Allerdings war da ein wichtige Hürde, über die ich hätte springen müssen: Ich hätte dran glauben müssen. Nur, weil mir jemand sagt: »Ja, Gott macht das.« oder »Gott sieht das.« oder »Natürlich steuert er jede Ampel.« (Letzteres ist Originalton.), muss es noch lange so sein. Das ist der springende Punkt bis zum heutigen Tag: Es gibt keinen Beweis, dass ER existiert.
Ich hatte unter der Woche das Missvergnügen in einer Kirche zu verweilen. Missvergnügen nicht, weil die Kiche unangenehm wäre, sondern der Anlass. Ich bin es einmal kurz durchgegangen. Ich habe definitiv an mehr Beerdigungen teilgenommen, denn an Hochzeiten. Hier liegt ein Missverhältnis vor, dass auch gegen IHN spricht. Das hätte ich auch als Ungläubiger nicht verdient! Sei’s drum. Ich war ziemlich überrascht, denn ich hatte JJ gar nicht einer Kirche zugerechnet. Aber wie oft redet man im Freundes- und/oder Kollegenkreis über seinen Glauben? In den letzten zehn Jahren, kann ich mich nur an ein einziges Gespräch in einer solchen Runde erinnern.
Der Pastor, ein Mann mit sonorer Stimme die einem robustem Körper entsprang, erzählte viel von Wut, Verzweiflung und Trost – Wut auf Gott, Verzweiflung in Gott und Trost durch Gott – darüber, wie ungerecht es wäre, einen Mann im besten Alter an Krebs erkranken und sterben zu lassen. Eine Erklärung hatte auch der Pastor nicht – wie das bei Glauben so ist, war es Fischen im Ungefähren und die Suche nach den richtigen Worten, um den Hinterbliebenen Trost zu spenden. Ehrenvoll – gewiss, hilfreich – vielleicht. Aber ob seine Erklärungen irgendetwas mit der Wahrheit zu tun haben? Eine rhetorische Frage.
Was sagte ein Freund nach der Trauerfeier: »Was hatte denn das mit JJ zu tun?«
Aber der Pastor bekam den Dreh, denn der folgende Teil der Trauerfeier, in dem er über JJ redete, sollte ein echter Höhepunkt werden. Es ging um das Leben und Wirken, Beruf und Familie. Dann kommt üblicherweise der Part, in dem der Geistliche die Beziehung des Verstorbenen zu Gott und zu seinem Glauben schildert, nur da gab es bei JJ nichts. Hier ließ der Pastor mit den richtigen Worten keinen Zweifel daran, dass JJ nicht an Gott glaubte. Er redete nicht von Zweifeln, er redete davon, dass der Glaube schlicht fehlte. So souverän habe ich das noch nie zuvor bei einer Trauerfeier in der Kirche gehört.
Einen Aspekt, den er dabei hervorhob, war, dass JJ vielleicht durch den mangelnden Glauben etwas an Zuversicht fehlen würde, die Hoffnung. In einem Glauben an Gott, hätte er vielleicht mehr Zuversicht und mehr Kraft gehabt. Ja, daran muss man wirklich glauben. Zuversicht und Hoffnung haben meiner Ansicht nach weniger mit dem Glauben an irgendetwas zu tun, sondern hauptsächlich mit der Persönlichkeit des Menschen.
Die Rede und Erinnerungen an JJ waren gut verpackt und die Sprache und Gestik des Pastors dazu war hervorragend. Ich war in Versuchung, dem Pastor dazu zu gratulieren. Ohne mit der Wimper zu zucken, kann ich sagen, dass er einen guten Job für die Hinterbliebenen-Familie gemacht hat.
Was für Ungläubige wie mich immer recht peinlich ist: Singen und Beten. Singen geht ja noch, wenn man dann irgendwann mit der Melodie mitkommt. Etwas irritierend war anfangs, dass man wirklich aufpassen muss: »Es wird Lied 398 gesungen, und davon die Strophen 1, 7, 9 und 24b.« Danke! (Das ist ein überspitztes Beispiel, bitte nicht nachschlagen! Nochmals danke!) Es gibt da meinerseits keine Vorbehalte, der Inhalt der Lieder ist mir recht egal. Es geht um das gemeinsame Erlebnis. Wenn es nach dem Text geht, dürfte ich als Norddeutscher auch nie bei »Walking on sunshine« mitsingen. Also. Das Beten geht aber gar nicht. Zu wem oder was? Nein, Gott ist nur in Floskeln bei mir und das reicht.
Zwei abschließende Gedanken: Trauerfeiern werden für die Hinterbliebenen durchgeführt, von daher ist es richtig, wenn JJ eine kirchliche Trauerfeier bekommen hat. Ich hoffe, dass es der Familie Trost gespendet hat und Trost gibt.
Gott hatte seine Chancen bei mir gehabt. Nun bin ich aber der Überzeugung, dass es an mir liegt, auf meine Schlüssel aufzupassen und ich fahre viel besser damit.