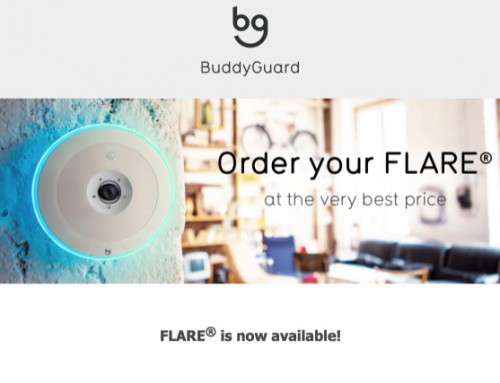Hin und wieder laufen in den Medien Diskussionen über deutsche Befindlichkeiten wie Stolz und Scham. Man ist verdammt Stolz auf Goethe und den Rest der Dichter, rühmt die hervorragenden Wissenschaftler und erinnert sich an Glanztaten wie das Wirtschaftswunder und den Fall der Mauer. Dann kommt man wieder dazu, erinnert sich an den 1. und 2. Weltkrieg, an den Massenmord an den Juden und spricht vor Scham. Wenn man sich nahezu hundertprozentig mit seiner Nation identifiziert, müsste man sowohl die Licht- wie die Schattenseiten annehmen. Damit tut man sich aber verdammt schwer.
Die Einen sehen nur das Licht, Andere schauen nur auf den Schatten und noch ganz Andere neigen dazu, den Schatten zu Licht zu verklären. Wofür man schon eine ganze Menge Fantasie benötigt. Mir persönlich ist das meistens ziemlich schnuppe: Es ist doch reiner Zufall, dass ich als Deutscher geboren wurde. Dafür kann ich nichts. Die Leistungen meiner Vorfahren waren nicht die meinen. Sie verdienen Hochachtung, aber nicht mehr Hochachtung als die Leistungen anderer Menschen anderer Nationalität. Die Verfehlungen meiner Vorfahren, die immer wieder gerne – und zu Recht – thematisiert werden, sind nicht meine Verfehlungen. Ich empfinde eine gewisse Scham dafür, Reue und Schuld kann ich aber nicht empfinden.
Interessanter ist es, sich mit der Gegenwart zu beschäftigen und in dieser darum anzugehen, dass man für seine Zeitgenossen – egal welcher Nationalität – Scham empfinden muss. Verwunderlich ist, dass ich eigentlich in dem Ruf stehe, ein Optimist zu sein, gar ein unverbesserlicher. In bestimmten Aspekten torpediere ich das aber: Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir vor Untaten, wie sie im zweiten Weltkrieg geschahen, für immer gefeit sind. Diesen Glauben habe ich aber nicht nur für das deutsche Volk nicht, nein, ich habe sie für überhaupt kein Volk der Welt. Beispiele dafür gibt es selbst in der jüngeren Geschichte genug.
Aber da bin ich von der Vergangenheit mal wieder in die Gegenwart abgeschweift, und bin gerade dabei, das Thema komplett zu verpassen. Also kommen wir zurück zum eigentlichen Thema: »Verschwörung gegen Amerika«. Vor dem Buch stand ich sicher schon, als es als Hardcover herausgekommen ist. Aber Philip Roth sagte mir vom Namen her etwas, ich hatte auch schon etwas von ihm gelesen – sicher fünfzehn Jahre her und ich muss sagen, es war nicht so mein Stil. Das Thema des neuen Buches, ein Gedankenspiel mit der amerikanischen Geschichte, interessierte mich aber schon.
Nun ist Philip Roth nicht der erste Schriftsteller, der mit seinem Roman versucht, eine Parallelwelt zu den Geschehnissen zwischen 1933 und 1945 herzustellen, womit der Einfall, der auf dem Buchrücken als »kühn« bezeichnet wird, ein wenig weit hergeholt scheint. Schon Harris hatte sich mit »Vaterland« an diesem Thema versucht, und Stephen Fry (hochgeschätzt und lange Zeit schriftstellerisch unproduktiv) hatte in »Geschichte machen« schon versucht, Hitler ungeschehen zu machen, mit unabsehbaren Folgen. Aber Roth wählte einen Ansatz, der nicht in Europa liegt, sondern der nach Amerika versetzt wird. Roth, und das ist wirklich ein wenig kühn, versetzt seine eigene Familie, seine eigene Kindheit in eine Vergangenheit, die es so – Gott sei Dank – nicht gegeben hat.
Charles Lindbergh, der, der als erste den Atlantik mit einem Flugzeug nonstop überquerte und später durch die Entführung und Ermordung seine Sohnes arg litt, war zu einem Helden der Hitler-Regierung geworden. Man kann es Anbiederung an das Regime nennen, dass er einen Orden des Hitler-Regimes entgegen nahm. Es ist auch bekannt, der er ein Antisemit war. Das macht ihn nicht gerade sehr sympathisch. Aus diesen bekannten Mosaik-Stückchen des Lebens Lindbergh macht Roth ein wenig mehr, in dem er die Geschichte Amerikas so ändert, dass sich Lindbergh entschließt, für die Präsidentschaft zu kandidieren und und letztlich auch Präsident wird. Das Kabinett besteht aus einer Reihe von bekannten Antisemiten.
Vater Roth erkennt vom ersten Augenblick, dass mit der Wahl von Lindbergh Ungemach auf die jüdische Familie Roth zukommt. Bisher lebte man als amerikanische Familie jüdischer Abstammung in einem Viertel von Juden. Man war sich seines Judentums aber gar nicht so bewusst. Das sollte sich alsbald ändern, denn die Antisemiten beginnen nach der Wahl Lindberghs sich Gehör zu verschaffen und auch die Familie muss bei einem Besuch Washingtons erkennen, dass sie als Juden angefeindet werden.
Roth erzählt eine politische Geschichte aus der Perspektive eines Kindes. So gerät das Familiäre in den Vordergrund, sympathischerweise möchte ich sagen. Der Vater vermochte zwar erkennen, dass Ungemach auf die Familie zukam, er während dieses Ungemach wie ein Unwetter aufzog, mochte er keine Konsequenzen daraus ziehen. Die Mutter stimmte dem Vater zu und bereitete eine Flucht nach Kanada vor. Der älteste Sohn dagegen mochte überhaupt gar nichts erkennen und begeisterte sich für die neue »Bewegung«, die Tante (die Schwester der Mutter) lässt sich sogar mit einem Juden ein, der sich an das System anbiederte und ein Vetter der Familie geht nach Kanada, um in den Krieg gegen Deutschland gehen zu können.
Die Mechanismen, die bei einer solchen gesellschaftlichen Veränderungen wirken, hat sich Roth nicht ausgedacht. Sie scheinen mir aus Tagebüchern deutscher Juden abgeschrieben zu sein, so sehr ähneln sich die Geschichten. Diese »Es wird schon nicht so schlimm werden«-Stimmung, die für so viele jüdische Familien den Untergang bedeutete, die die Chance hatten, zu flüchten, aber es nicht taten, sich darauf verlassend, dass es doch auch noch »anständige Leute« gäbe.
Hinzu kommt, dass hier ein Szenario durchgespielt wird, das meine Überzeugung stärkt, dass es keine »anständigen« Völker gibt. Jede lässt sich zu Verbrechen aufstacheln, wenn nur ein geschickter »Führer« daherkommt, der die Massen mittels der Medien zu lenken weiß. Das, was was in Deutschland passiert ist, lässt sich auch auf andere Staaten übertragen, auch auf die USA. Ohne Probleme. Wenn die Zeit reif ist und die richtige, falsche Führungspersönlichkeit kommt.