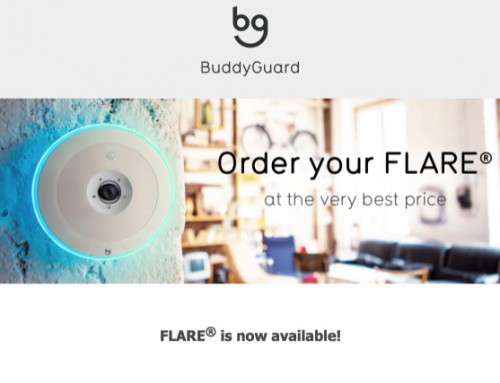Früher gab es Ansager, nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Dörfern und Städten und zumindest in Holland. Die zogen durch die Straßen und kündeten von dem Tod eines Mitbewohners. Auch die Kinder von Bestattern wurden auf die Straße geschickt, um den Tod von Kindern anzusagen. So manche Karriere als Bestattungsunternehmer begann auf diese Art und Weise, weiß Maarten ›t Hart in seinem Buch »Gott fährt Fahrrad« zu berichten.
Im Holländischen, ohne dessen mächtig zu sein, bezog sich das Buch im Titel auch auf diese Sitte. Aber das ist nur eine Vermutung. Sicher nicht zu weit hergeholt, denn ein Biologe berichtet über seinen Vater, der in seiner Heimatstadt Totengräber war. Der Vater hatte eine Angewohnheit, die ihm sicher von vielen übel genommen wurde: Er sagte was er dachte und kannte dabei keinerlei Diplomatie. Der Friedhof war sein Reich und auf dem duldete der König weder Kaiser noch Grafen. Wer nicht auf den Friedhof gehörte, wurde verjagt.
Grabsteine beispielsweise mochte der Totengräber überhaupt nicht leiden. Sie machte ihm nur Ärger. Er musste sie beseitigen, wenn die Liegezeit abgelaufen war und auch im täglichen Leben machten sie nur Ärger. Die Angehörigen der Liegenden wollten nicht nur, dass sie geputzt und geschliffen wurde, natürlich musste das Gras auch sauber um sie herumgeschnitten sein. Als Friedhofsgärtner hatte man den Ärger nicht, wenn die Grabsteine gar nicht erst da wären. Von daher versuchte er dem Steinmetz des Ortes stets ein Schnippchen zu schlagen, in dem er seiner Kundschaft empfahl, das mit dem Stein zu lassen.
Nun kam der Vater eines Tages ins Krankenhaus. Er hatte schon immer einen empfindlichen Magen gehabt, der nur mit warmer Milch beruhigt werden konnte. Hier im Krankenhaus wurde er ordentlich durchgecheckt und für eine Operation vorbereitet. Die Operation, so wunderte sich sein Sohn, verlief reichlich flott und auch sein Vater war wohl verwundert: »Ich habe überhaupt gar keine Schmerzen. Das ist schon komisch und ist mir nicht geheuer«, sagte er sinngemäß zu seinem Sohn. Im Krankenhaus war man nicht bereit, dem Sohn zu sagen, was mit dem Vater los war. Er musste sich einen Termin beim Hausarzt holen und der musste er umständlich die Unterlagen aus dem Krankenhaus beschaffen. Letztlich wird dem Sohn eröffnet, dass der Vater an einem inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Sie sprechen nicht darüber, wie lange der Vater zu leben hätte, aber der Sohn hatte erfahren, dass es sich nur noch um einen sehr beschränkten Zeitraum handeln würde.
Es war nicht einmal gewiss, ob der Vater sein Ziel erreichen würde und älter als sein Bruder werden würde. Eine schreckliche Situation für den Sohn, der nicht weiß, ob er das Erfahrene dem Vater mitteilen soll oder nicht. Der Arzt ist der Meinung, der Vater würde sich gut erholen und es wäre schade, ihn mit so einer Nachricht konfrontieren, denn viele Männer auf dem Weg zur Genesung (wenn auch nur zu einer zwischenzeitlichen), könnten mit einer solchen Nachricht nicht umgehen, täten sich in die Ecke setzen und würden anfangen, vor sich hinzusiechen, um dann einfach zu sterben.
Der Vater lebt weiter mit der Vermutung, dass irgendwas nicht stimmt. Er weiß nicht, dass er schwer krank ist, aber er ahnt es irgendwie. Sein Tagwerk lässt er sich nicht verderben. Immer noch traktiert er seine Mitmenschen und die Friedhofsbesucher mit Bibelzitaten.
Sein Sohn indes weiß es. Auf der Suche nach dem richtigen Zeitpunkt wird er immer ratloser (nein, nicht vor dem Frühjahr; nein, nicht vor dem Geburtstag; nein, die Weihnachtszeit ist auch nicht passend). Er mag nicht versauern, aber er bekommt immer schlechtere Laune, die sich auf seine ganze Umgebung überträgt. Besser, er hätte nicht gefragt, mag man sich denken. Denn die lockere Art des Vaters, der sagt, er würde schon noch gern bleiben, aber wenn der Herr es will, dann geht er, die hat der Sohn – ungläubig – nicht. Das Päckchen, das man ihm aufgebürdet hat, muss er ganz allein tragen.
Sicher ist es keine leichte Lektüre. Hart schafft es trotzdem, den Leser auf diese Reise mitzunehmen. Man hat sich unbequeme Wahrheiten anzuhören, wie zum Beispiel:
Mein Vater, begriff ich plötzlich, hatte immer zwischen mir und dem Tod gestanden, einmal weil er so stark war, so furchtlos, so unerschrocken, zum anderen wegen seines Berufs. Solange er nicht tot war, konnte ich nicht sterben, aber wenn er sterben würde, war ich danach an der Reihe. Es war gleich, ob dieses Danach sofort eintreten würde oder nach vielen Jahren: Es war danach.
Ich hatte es in »Jetzt sind wir an der Reihe« angesprochen. Erst die Oma, dann die älteren Onkel und Tanten, dann die Eltern und schon mussten wir uns damit auseinandersetzen. Wenn man die vierzig überschritten hat, schreibt Hart, muss man sich abfinden, dass man die Hälfte des Lebens hinter sich hat. Wer mag schon gern daran denken?
Aber dann gibt es wunderbar skurile Geschichten vom Friedhof zu hören und herrliche Erinnerungen aus der Kindheit, so dass man nicht aufhört zu lesen, obwohl sich das gesamte Buch um den Tod und Abschied dreht. Letztlich erfährt man sogar noch, wie es sich mit Gott auf dem Fahrrad verhält und vielleicht sogar, warum der Sohn im Gegensatz zu seinem Vater seinen Glauben verloren hat.