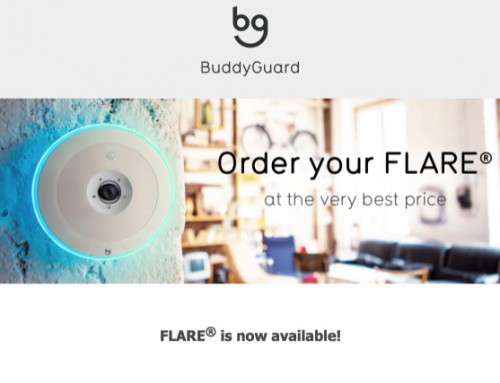Genaugenommen, seien wir ehrlich, sind die Muster, die uns in den klassischen englischen Krimis gegegeben werden, ebenso wie der Aufbau des Buches typisch. Sie erinnern mit ein wenig an die klassische Sonatensatzform, die auch einem bestimmten Muster entsprach. Wir erinnern uns: die Figuren werden eingeführt und man darf sich aussuchen, wer es von den Personen verdient hat, zu sterben. Die Konflikte werden dem Leser vorgestellt, von dort aus geht es nach einem Drittel des Buches darum, die Leiche zu entdecken. In einem guten, blutrünstigen englischen Krimi sollten mindestens zwei von denen auftauchen, möglichst in einer Kombination, die es nicht sofort erlauben, Zusammenhänge zu erkennen und das Bild, welches sich der Leser gemacht hat, völlig über den Haufen wirft. Dann zittert man mit dem Inspektor (oder Privatdetektiv), auf dass er den Mörder findet, schließlich hat dieser häufig noch ein weiteres Verbrechen im Sinn. Meist natürlich nur um seine vorherigen Morde zu vertuschen oder die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Aber es gibt ja noch den Detektiv, der sich nicht so leicht unterkriegen lässt.
Das Schöne ist: wenn es gut gemacht ist, funktioniert es jedes Mal. So auch in diesem Roman von P.D. James.
Die Geschichte beginnt an einem Freitag, Ende Oktober. Wie das Wetter in London sein dürfte, kann sich jeder gut vorstellen. Genauso grauselig wie man es in Edgar-Wallace-Filmen zu sehen bekommt. Adam Dalgliesh hat an diesem Tag die Gelegenheit das Dupayne-Museum (ich bediene mich mal der deutschen Schreibweise) kennenzulernen. Er wird von Conrad Ackroyd, einem alten Freund und Förderer Daglieshs, zu diesem Museum entführt. Das Museum beschäftigt sicht mit einer relativ kurzen Zeit: den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts und hatte alles gesammelt, was für diese Zeit relevant sein dürfte. Dazu gehört auch der Saal der Mörder, den man den spektakulärsten und mysteriösesten Kriminalfällen dieser Zeit gewidmet hatte.
Gegründet wurde das Museum von dem Namensgeber gegründet, der viel Zeit und Geld in dieses Projekt steckte; so viel Zeit und Geld, dass er seine Familie dafür vernachlässigte. Während seine beiden ältesten Kinder sein Werk fortsetzen, war der jüngste Sohn nicht bereit, dieses Projekt, welches – nach seiner Meinung – den Vater von der Familie entfremdete, weiter zu unterstützen. In seinem Testament hatte der Vater verfügt, dass das Museum nur dann weitergeführt werden könnte, wenn alle Kinder den Pachtvertrag für das Museum unterstützen würde. Dupaynes jüngster Sohn Neville hatte nun die Gelegenheit, ordentlich aufzuräumen.
Der Mann war Psychologe und betrieb erfolgreich eine Praxis. Er hatte die Angewohnheit, am Wochenende mit seinem Auto verreisen und schaute sich mal diesen Landstrich an, mal jenen. Dazu fuhr er freitags zum Dupayne, wo er sein Auto untergestellt hatte, und düste dann los. Als die gute Seele des Museums an einem Freitag nach Hause kam, kam ihr ein Auto entgegen, und fuhr sie an. Ein junger Mann stieg aus dem Auto und fragte die geschockte ältere Frau, ob es ihr gut ginge. Bevor er davon rauschte, wies er auf das Haus und meinte, da würde ein ganz schönes Feuerchen brennen.
Dies ist eine Bemerkung, die der guten Seele gar nicht gefällt und als sie zum Haus blickt, sah sie, dass es dort in der Tat brannte. So schnell wie möglich machte sie sich auf den Weg zum Haus und sah, dass das Feuer in der Garage wütete, stellte fest, dass in dem Auto jemand verbrannte. Da es das Auto von Neville Duprayne war, konnte sie sich gut vorstellen, dass er das Opfer geworden war und teilte dies auch jedermann so mit. Ihre Befürchtungen sollten sich bestätigen.
Nun mag es naheliegen zu sagen, man habe ihn aus dem Weg geräumt, weil er gegen den Fortbestand des Museums war und es eine Menge Leute ein großes Interesse daran, ihn um die Ecke zu bringen, nicht nur, weil er sie um ihr Hobby bringen würde, nein, manche würde er vor arge existenzielle Probleme stellen. Für sowas geht man schon mal etwas rabiater um.
Das ist aber nur eine kleine Spur, denn in der Regel liegen die Wurzeln in solchen Romanen etwas tiefer und P.D. James enttäuscht in dieser Hinsicht nicht. Dachte ich anfangs noch, aha, wieder mal so ein typischer Krimi, so musste ich später sagen, ja, das ist ein typischer Krimi von P.D. James, der gewisse Ähnlichkeiten zu ihrem letzten großen Roman (»Tod an heiliger Stätte«) aufweist; aber nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade wegen dem Gewohnten, war es wieder einmal sehr spannend zu lesen. Man kann nicht sagen, dass James ihre Meisterschaft verloren hat.